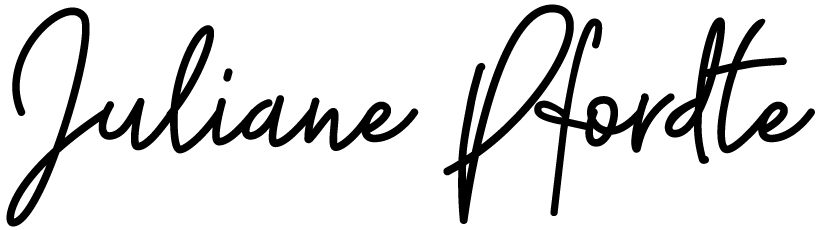Brandenburger Tor am 10. November 1989. Foto: Barbara Klemm
»Alle meine Träume sind schwarzweiß«
Mit ruhiger Hand zieht Barbara Klemm ihre Tasche an sich, um sich ihres wertvollsten Inhalts zu vergewissern: »Meine Leica habe ich immer dabei.« Jahrzehntelang dokumentierte die frühere FAZ-Fotografin deutsch-deutsche Geschichte, hielt politische Umbrüche und historische Momente fest. Ihre Fotos haben sich ins kollektive Bildgedächtnis eingeschrieben.
Das Interview fand 2016 im Rahmen der Ausstellung Zeitsprung. Erich Salomon / Barbara Klemm in der Stuttgarter Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen statt.
ifa: Frau Klemm, Ihre Schwarzweißfotos stehen für eine fast schon vergessene Ära der Pressefotografie. Sie haben mal gesagt, dass Sie auch schwarzweiß träumen. Ist das wirklich so?
Barbara Klemm: Ja, soweit ich mich erinnern kann, sind alle meine Träume schwarzweiß. Träumen Sie bunt?
Ja, ziemlich bunt sogar. Nun waren Sie durch die Zeitung zunächst festgelegt auf Schwarzweißfotografie. War es trotzdem eine bewusste Entscheidung?
Ich habe auch zwei Jahre lang Farbe fotografiert, aber das war nicht mein Metier. Meiner Meinung nach lassen sich Inhalte in Schwarzweiß deutlicher und schneller vermitteln. Strukturen werden in Grau- und Schwarzweißtönen sehr viel klarer. Vielleicht wirkt ein farbiges Bild auf den ersten Blick anziehender, weil es einem sofort ins Auge springt. Aber für ein gelungenes Farbfoto braucht man Zeit und Gestaltungsspielraum und das hat man in der Reportage-Fotografie nicht. Mir war es immer wichtig, dass das Bild neugierig auf den Artikel macht. Zwischen einem Schwarzweißfoto und Text besteht eine Homogenität. Das Bild platzt nicht heraus, es verstärkt den Text, wenn es ein gutes Bild ist.
Was macht denn ein gutes Bild aus?
Eine gute Komposition: die Aufteilung des Bildes in klare Formen, die den Inhalt schnell vermitteln und ordnen – das ist für mich ein gutes Bild.
Ist dieser Anspruch künstlerisch geprägt? Ihre Eltern waren ja beide Maler.
Ich bin mit Kunst groß geworden, das hat mich immer umgeben und unbewusst sicher sehr geprägt. Ich ging oft mit meinem Vater ins Museum und staunte, was er alles über Malerei wusste. Davon ist sicher viel hängen geblieben. Er sagte immer, ich hätte das in mir, den Blick für eine gute Komposition. Bis zu einem gewissen Punkt kann man das aber auch trainieren. Betrachten, beobachten, sich dabei bewegen – das schult.
Und warum haben Sie sich für Fotografie entschieden?
Auch das war eine Idee meines Vaters. Er schlug eine Fotografenlehre vor. Die Ausbildung machte ich in einem Porträtatelier in Karlsruhe. Danach war ich kurzzeitig in einer Repro-Firma angestellt, aber langfristig wäre ich dort eingegangen wie eine Primel. Es war furchtbar, immer nur Streifenanzeigen herzustellen. Dann ergab sich ein glücklicher Zufall. Eine Kollegin sollte nach Frankfurt gehen und für die FAZ in der Klischeeherstellung arbeiten, also die Druckvorlagen für die Zeitungsfotos herstellen. Weil sie die Stelle dann doch nicht wollte, bekam ich sie.
Bei der FAZ lernten Sie den Fotografen und späteren Kollegen Wolfgang Haut kennen. Er regte Sie dazu an, journalistisch zu arbeiten, was sie ab 1970 auch gemacht haben. Wie war es für Sie als Frau in der damals eher männlich geprägten Fotografiewelt?
Ich habe eigentlich immer nur versucht, meine Sache gut zu machen. Der Rest war mir egal. Klar habe ich gemerkt, dass mich die Kollegen zunächst immer etwas von oben herab behandelten und wohl dachten: "Die Kleine da, was die wohl will." Aber letztlich waren es meine Fotos, die sich gegen die der männlichen Kollegen durchsetzen mussten. Und mit der Zeit merkten sie, dass meine Bilder nicht nur Eintagsfliegen waren.
Leonid Breschnew, Willy Brandt, Bonn, 1973. Foto: Barbara Klemm
Hatte es auch Vorteile, eine Frau zu sein?
Bei meinen Kollegen weniger, aber in der Politik schon, zum Beispiel beim Treffen von Willy Brandt und Leonid Breschnew. Dass ich überhaupt dort fotografieren durfte, lag sicher auch daran, dass ich jung und die einzige Frau war. Als Breschnew in den Konferenzraum kam und mich sah, meinte er: "Endlich mal eine Frau, Männer habe ich ja immer hier." Auch bei meinen Reisen in die ehemalige Sowjetunion war es von Vorteil, ich konnte mich freier bewegen. Man hatte keine Angst vor mir, man unterschätzte mich und meine Arbeit. Im Nachhinein weiß ich, dass das der Grund war, warum ich selten Ärger beim Fotografieren hatte.
Sie haben nicht nur Politiker fotografiert, sondern auch Landschaften und den Alltag vieler Menschen weltweit. Welche Art von Fotografie hat Sie am meisten fasziniert?
Mich haben immer die Menschen interessiert – das, was im öffentlichen Raum passiert, was man auf der Straße beobachten kann. Das ist auch der Raum, der uns Fotografen am leichtesten zugänglich ist. Es reizt mich, Menschen zu beobachten und zu sehen, wie eine Situation mitten aus dem Leben wie eine Inszenierung wirkt – als hätte ein Regisseur die Menschen dort so hingestellt. Wenn es mir glückt, diese Momente einzufangen, ist das ein großartiges Gefühl. Architektur hingegen hat mich weniger gereizt, obwohl mir trotzdem ein paar gute Aufnahmen gelungen sind.
Wie haben die Menschen reagiert, wenn sie merkten, dass sie fotografiert wurden?
Wenn jemand nicht wollte, dass ich das Bild verwende, habe ich das immer akzeptiert. Wenn jemand aggressiv wurde – auch das kam ab und zu vor –, habe ich versucht zu vermitteln und erklärt, dass ich für die Zeitung arbeite und mir die Situation einfach sehr gut gefiel. Heute besteht gegenüber Berufsfotografen eine besondere Empfindsamkeit, die es damals so nicht gab. Obwohl doch heute jeder alles fotografiert und Bilder von sich ins Netz stellt, ist den Leuten das Recht am eigenen Bild wichtiger geworden.
»Die Kunst liegt darin, sich selbst zurückzunehmen, das richtige Gespür für Nähe und Distanz zu haben.«
Wie haben Sie es geschafft, immer Abstand zu wahren zu dem, was sie fotografierten?
Die Kunst liegt darin, sich selbst zurückzunehmen, das richtige Gespür für Nähe und Distanz zu haben. Es geht darum, zu beobachten, nicht zu stören oder das Geschehen zu verändern. Das ist verdammt schwer, es verlangt Konzentration und Erfahrung.
… Erfahrung, die Sie hatten, als Ihnen die Aufnahmen vom Mauerfall 1989 gelangen.
Ich denke, es war für uns alle unglaublich, noch zu Lebzeiten diese Mauer und das Regime dahinter fallen zu sehen. Es war das wichtigste Ereignis in meiner gesamten Laufbahn als Fotografin. Ich musste meine eigenen Emotionen sehr zurückhalten, um wirklich sehen zu können, wo sich das Geschehen verdichtete. Ich hatte schon die Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz miterlebt, aber da ahnte ich nicht, was wenige Tage später passieren würde.
Öffnung des Grenzübergangs am Brandenburger Tor, 22. Dezember 1989. "Für mich das Symbol der Wiedervereinigung", sagt Barbara Klemm. Foto: Barbara Klemm
Erinnern Sie sie noch, was Sie am 9. November ‘89 gemacht haben?
Ich war unterwegs, kam erst spät nach Hause. Als ich den Fernseher einschaltete, wurde die Sendung plötzlich "aus gegebenem Anlass" abgesetzt, dann zeigten sie Helmut Kohl, der aus Warschau über die Ereignisse in Berlin sprach. Da war mir sofort klar, dass ich am nächsten Morgen den ersten Flieger nach Berlin nehmen würde. Es war irre, wie die Menschen nicht nur vor, sondern auch auf der Mauer standen und jubelten. Auch ich kletterte hoch, ich wollte ja sehen, wie es im Osten aussah. Das war Wahnsinn, es gab nur eine einzige Leiter. Von dort fotografierte ich die junge Frau, die den Grenzbeamten um ein Autogramm bat. Es war so voll, dass man Angst hatte, aus Versehen jemanden runter zu schubsen. Dann drehten sich plötzlich alle in die andere Richtung, wo Willy Brandt, Dietrich Stobbe und Walter Momper standen. Wie gerne hätte ich die drei Berliner Bürgermeister mit der Mauer im Hintergrund fotografiert! Aber zum Springen war es zu hoch und die Leiter war zu weit weg. Also machte ich das Bild der drei von oben.
Fall der Mauer, 10. November 1989. Foto: Barbara Klemm
Und waren damit die Einzige mit dieser Perspektive.
Ja, das habe ich mir bei Erich Salomon abgeschaut: Wenn etwas schief geht, muss man nach Alternativen suchen und sich anders Zugang zu verschaffen.
Haben Sie ein Beispiel?
Bei einem Treffen von François Mitterand und Helmut Kohl hatte ich vergessen, einen Film einzulegen. Das bemerkte ich aber erst, als ich den Saal verließ. Da stand ich mit hochrotem Kopf, während alle anderen Kollegen abschwirrten.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ich drehte eine Runde um das Gebäude – das war ein kleines Schlösschen in der Pfalz. Und so gelang mir ein gutes Foto von Kohl und Mitterand, als sie mit der Dolmetscherin aus dem Fenster auf die Pfälzer Landschaft blicken. Das Foto war sehr schwer zu vergrößern, aber es war ein Motiv, das alle anderen Fotografen nicht hatten.
Auch das Bild von Helmut Kohl anlässlich seines 65. Geburtstags ist einzigartig, eine intime Momentaufnahme seiner Macht.
Als ich diesen Auftrag erhielt, wusste ich, dass ich den Kanzler mit seinen engsten Mitarbeitern bei der Arbeit zeigen möchte. Man kann Politiker immer besser in Aktion fotografieren. Ich brachte ihm zwei Bilder mit: eins vom Anfang seiner Karriere, der Gratulation von Helmut Schmidt nach dem Misstrauensvotum, und eins vom Höhepunkt, dem 3. Oktober 1990 auf der Balustrade vor dem Reichstag. Daraufhin fragte er mich, wie ich es denn haben wollte. Auf diese Frage hatte ich gehofft.
Foto: Barbara Klemm
Und wie wollten Sie es haben?
Ich bat ihn, so zu arbeiten wie immer, als ob ich nicht da wäre. So konnte ich ihn vom Hintergrund aus beobachten und fotografieren. Als er nach einer halben Stunde meinte "Jetzt reicht's", tat ich so, als hätte ich es nicht gehört und machte einfach weiter. Das hätte ich mich früher nicht getraut, aber er ließ mich gewähren. Das richtige Gespür dafür, das Beobachten, Abwägen, ist immer eine große Anstrengung. Danach war ich so erschöpft, als hätte ich Kohlen geschaufelt.
Wäre das Schreiben für Sie die einfachere Alternative gewesen?
Schreiben ist eine hohe Kunst. Texter haben es aus meiner Sicht erheblich schwerer als Fotografen. Ich habe die Redakteure immer dafür bewundert, wie sie die Geschichten, die wir zusammen erlebt hatten, mit Worten auf den Punkt brachten.
Wäre es für Sie auch infrage gekommen, in Kriegsgebiete zu gehen?
Nein, davor hatte ich zu große Angst. Das müssen Leute machen, die dafür ausgebildet sind, sich bewusst darauf einlassen und einen inneren Drang verspüren. In Kriegsgebiete zu ziehen, nur um ein sensationelles Bild zu machen oder berühmt zu werden, das war nicht meine Sache. Auch wenn man sehr erfahren und vorsichtig ist, kann es einen treffen. Das habe ich auch Anja Niedringhaus bei unserem letzten Treffen gesagt, vier Wochen bevor sie in Afghanistan erschossen wurde.
Was würden Sie jungen Fotografen heute mit auf den Weg geben?
Wenn man begabt ist, den Beruf unbedingt ausüben will und fleißig ist, kann man auch heute mit Fotografie erfolgreich sein. Es gibt viele Ausbildungswege und Möglichkeiten, von der Architektur, über Mode, Kunst bis hin zu Journalismus. Aber es ist schwierig, seine Nische zu finden und bei der Masse an digitalen Fotos etwas Beständiges zu schaffen.
Wie stehen Sie zur digitalen Fotografie?
Sie ist mir zu perfekt. Man kann sich heute nicht mehr sicher sein, ob die Dinge wirklich so stattgefunden haben, wie sie auf Bildern gezeigt werden. Man kann sehr viele Details manipulieren, was gute Redaktionen zum Glück nicht zulassen.
Also fotografieren Sie noch heute analog?
Ja, und dabei bleibe ich. Selbst mit einer digitalen Leica würde ich nicht arbeiten. Die Firma wollte mir großzügiger Weise ein Exemplar schenken, anlässlich der Verleihung des Leica Hall of Fame Awards. Da meinte ich: "Wenn das die Bedingung ist, kann ich den Preis nicht annehmen." Das war ein netter Versuch, mich zur digitalen Fotografie zu verführen. Ich durfte mir dann eine analoge Kamera aussuchen.
© ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) 2016
Barbara Klemm wurde 1939 in Münster geboren. Nach der Ausbildung in einem Porträtatelier in Karlsruhe begann sie 1959 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zu arbeiten: zunächst in der Klischeeherstellung, von 1970 bis 2004 als Redaktionsfotografin mit dem Schwerpunkt Feuilleton und Politik. Seit 1992 ist sie Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg. Im Jahr 2000 übernahm sie eine Honorarprofessur im Fach Fotografie an der Fachhochschule Darmstadt. Barbara Klemm lebt heute in Frankfurt am Main.
Sie möchten weiterlesen?