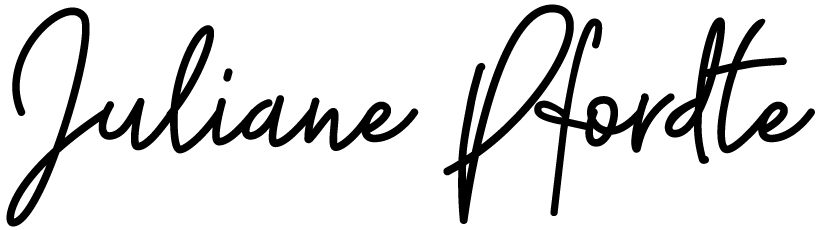Florian Ebner kuratierte den Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig 2015. Foto: Manuel Reinartz
Fotografie – wie ein Haus mit vielen Zimmern
Florian Ebner war der erste Fotokunst-Experte, der den Deutschen Pavillon in Venedig kuratiert hat. Im Interview spricht der gebürtige Regensburger über seine Leidenschaft für Fotografie, die Arbeit als Kurator und seine Idee vom Pavillon als Fabrik.
Das Interview wurde im August 2015 Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen geführt und erschien im Original auf einer früheren Website des ifa.
ifa: Sie haben Fotografie studiert, leiten aktuell die Fotografische Sammlung im Museum Folkwang in Essen und Sie haben den Deutschen Pavillon auf der diesjährigen Biennale Venedig kuratiert. Welche Seele in Ihrer Brust ist stärker – die des Fotografen oder des Kurators?
Florian Ebner (lacht): Meine Zeit als Fotograf liegt hinter mir. Ich habe bis 2006 in diese Richtung gearbeitet, dann aber gemerkt, dass es so viele gute Leute gibt, die mit Fotografie etwas zu sagen haben, dass es nicht auch noch meinen Beitrag braucht. Aber es ist schon immer auch noch das Auge in mir wach, das selbst mal fotografiert hat. Dadurch verstehe ich Fotografen heute besser, ich kann mich besser in sie hineinversetzen. Es ist gut, diese Erfahrung zu haben. Aber für einen Kurator ist es auch schön, das Zeitgenössische gegen das Historische einzutauschen und sich damit zu beschäftigen, was die Generationen vor uns gemacht haben. Gerade in der Fotografie und mit ihrem historischen Umgang kann man im Zeitgenössischen viel lernen. Die Fotografie hat sich selbst in den letzten Jahrzehnten als braves, legitimes Museumskind akzeptiert, aber sie war immer auch sehr wild. Die große Herausforderung ist es, das Wilde und Populäre ins Museum zu bringen.
Ist das auch Ziel Ihrer Arbeit in Essen?
Ja, ich stelle mir immer wieder die Frage – natürlich mit Respekt vor der Geschichte – wie man heute Geschichte mit jener Zeitgenossenschaft ausstellen kann, die sie damals hatte. Das ist ein Anspruch, den jeder Kurator haben sollte – besonders in der Fotografie und gerade in der heutigen Zeit des sich ändernden Bildjournalismus und der Verführungskraft der Werbung.
Das journalistische Bild taucht in Ihrer Arbeit immer wieder auf, nicht nur in Venedig, zuletzt auch in der Ausstellung Conflict, Time, Photography im Museum Folkwang, einer Übernahme der Tate Modern London.
Ja, mein Interesse gilt einer Art von Fotografie, die sich der Welt und dem Geschehen zuwendet. Aber wir haben in Essen auch eine wunderschöne Sammlung experimenteller Fotografie, zum Beispiel die Fotogramme von László Moholy-Nagy. Fotografie ist so ein vielgesichtiges Medium. Man hat so viele Orte, Bildkulturen und Sichtweisen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das ist wie ein Haus, in dem man jeden Tag in einem anderen Zimmer wohnen kann, wie Gustav Seibt mal gesagt hat.
2014 hat Sie Außenminister Frank-Walter Steinmeier offiziell zum Kurator des Deutschen Pavillons berufen. War das für Sie als Fotografie-Experte eine Art Ritterschlag?
Zunächst war es eine persönliche Herausforderung. Erst einmal musste ein Konzept für das Gebäude des Deutschen Pavillons erarbeitet werden – ein Gebäude, in dem schon so viel herausragende Kunst gezeigt wurde. Andererseits war es eine mutige Entscheidung des Gremiums, jemanden wie mich auszuwählen, der sich für die technischen Bilder interessiert und einen spezifischen Fokus auf die Kunstproduktion richtet. Dass sie einen Fotografie-Spezialisten ausgewählt haben, zeigt wohl auch, dass die Bereiche technische Bilder und mediale Öffentlichkeit momentan als sehr spannend wahrgenommen werden.
Wie haben Sie eigentlich von der Berufung erfahren?
Durch eine SMS von der Vorsitzenden des Auswahlgremiums. Im allerersten Moment dachte ich, es sei ein Kunststudent, der sich einen Scherz erlaubt und die Reaktionen von Kuratoren testet. Aber es hat sich ja dann doch alles als ganz seriös herausgestellt.
Jetzt hätte man von einem Fotografie-Spezialisten mehr fotografische Arbeiten in Venedig erwarten können. Mit Tobias Zielony ist aber nur eine fotografische Position vertreten. Was war ausschlaggebend für die Auswahl der Künstler?
Die Grundidee war, vom heutigen Zustand der Bilder auszugehen. Wir leben in einer Zeit, in der die Fotografie zwar eine sehr große Rolle spielt, aber immer im Zusammenspiel mit anderen digitalen, zirkulierenden Medien, Bildern und Informationen. Mir ging es darum, Künstler zu finden, die sich mit dem Zirkulieren von Bildern, von Menschen, Waren und Informationen auf ganz unterschiedliche Weise auseinandersetzen. Ich wollte einen Pavillon vor dem Horizont des Digitalen zusammenzustellen, was nicht heißt, dass ausschließlich digitale Bilder zu sehen sind.
Das heißt, es geht um eine Art Denkmodell der Fotografie?
Ja, ich wollte mir von Anfang an die Möglichkeit offenhalten, nicht nur klassische gerahmte Fotografien auszustellen, sondern Arbeiten, die sich an dem inspirieren, was Fotografie heute ausmacht. Es geht um Teilhabe und Zeugenschaft. Heute müssen wir uns fragen: Welche Bilder sehen wir eigentlich? Wovon berichten wir? Wer spricht und wer sieht diese Bilder, die einen vermeintlich dazu einladen, am Leben anderer teilzuhaben und die in ihrer Masse oftmals von gar nicht mehr berichten als darüber, wo die Deutschen heute ihren Urlaub verbringen. Wir leben in einer Zeit, in der man Künstler einladen möchte, sich mit dieser Bilderflut auseinanderzusetzen und damit anders umzugehen.
Ist es durch die Bilderflut auch schwieriger geworden, Fotokunst zu erkennen?
Ich glaube, es gibt unglaublich viele Formen von Kunst, die mit und über Fotografie entsteht. Das möchte ich wirklich unterstreichen, denn ich bin immer wieder gefragt worden, warum ich mich nicht für diesen oder jenen Fotografen entschieden habe. Den autonomen Autor, der Bilder schöpft, gibt es noch weiterhin, aber es gibt so viele andere interessante Künstler, die nicht primär Bilder schaffen, sondern auf die Präsenz der Bilder reagieren und daraus heraus analytisch arbeiten. Und das ist spannend, weil sie uns einen ganz anderen Zugang zu Bildern erlauben – weil sie Schneisen schlagen in diesen wuchernden Wald der Bilder.
Gehen wir durch die Schneise in den Deutschen Pavillon nach Venedig. Wie setzen die Arbeiten das Thema der Teilhabe an der Welt um?
Die Arbeit von Hito Steyerl zum Beispiel hat die Frage nach der Teilhabe in der digitalen Welt aufgegriffen. Tobias Zielony wiederum hat seine Kamera afrikanischen "refugees" zur Verfügung gestellt und afrikanische Autoren gefragt, wie sie die Flüchtlinge und das westliche Interesse, das des Fotografen daran sehen. Jasmina Metwaly und Philip Rizk haben den Begriff ganz anders eingelöst, nämlich indem sie ägyptische Arbeiter eingeladen haben, die Machtverhältnisse in Ägypten in einer Art Kammerspiel nachzustellen.
Auch in dem Werk von Olaf Nicolai spielt Teilhabe eine Rolle. Seine Arbeit ist eine Performance auf dem Dach des Pavillons, das Sie als erster Kurator in die Ausstellung mit einbezogen haben. Soll das Dach dem Besucher seinen eigenen Voyeurismus, die Illusion der Teilhabe, vor Augen führen?
In gewisser Weise. Olaf Nicolais Arbeit spielt mit der Dialektik der plötzlichen Sichtbarkeit und des Sich-Zurückziehens als Reaktion auf die generell beanspruchte Teilhabe an allem jederzeit. Der Begriff der Teilhabe ist heute so abgenutzt und tatsächlich oft nur eine Illusion, wie Hito Steyerls Arbeit schön zum Ausdruck bringt: Wir glauben, wir könnten an all dem teilhaben, was in der vernetzten Welt passiert, aber im Grunde sind wir nur Marionetten in einem Spiel. Wir sind inzwischen so weit, dass es wichtig ist, nicht präsent oder sichtbar zu sein, andere auszuladen. Das Dach ist also auch ein Ort der Freiheit für diejenigen, die oben sind. Sie können sich zurückziehen, um ihre Arbeit zu verrichten – in dem Fall, um Bumerangs herzustellen – und sie können selbst entscheiden, sichtbar zu werden, wenn sie an den Rand des Dachs treten.
Liegt darin also die heutige Herausforderung im Umgang mit Bildern?
Ja, auch für die Künstler, die sich der Herausforderung der Grenzziehungen stellen müssen. Sie müssen darüber nachdenken, was eigentlich sichtbar ist, wer etwas sichtbar macht und was sichtbar sein soll. Die Herausforderung liegt in der Ökonomie des Umgangs mit Bildern und Informationen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem viele Künstler auch gute "editors", also Herausgeber und Redakteure sein müssen für das, was um sie herum passiert.
Wie hat sich die Rolle der Bilder im vergangenen Jahrhundert verändert?
Ich glaube, dass uns der heutige Blick zurück zeigt, dass wir auch schon im 20. Jahrhundert in einer sehr mediatisierten Gesellschaft gelebt haben. Schon der Spanische Bürgerkrieg war ein extrem "gebroadcasteter" Krieg in den Illustrierten der damaligen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der wir sensibler werden für das, was Bilder uns zeigen, in der die Medienkritik wächst und auch das Bewusstsein darüber, dass wir der Bilderflut ausgeliefert sind. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Aber natürlich können Bilder auch die Welt verändern, wie die Bilder des Vietnamkriegs und ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung gezeigt haben. Heute haben wir die Propagandavideos des IS, vor zwei Jahren hat man Facebook-Bilder vom Arabischen Frühling als positive Kanäle und Netzwerke betrachtet. Jetzt redet man über ihre Verführungskraft. All das ist Teil einer großen Form von Sichtbarkeit der Bilder, einer Macht, die längst durch die Bildschirme hindurch in unser Leben hineinwirkt.
Sie haben dem Pavillon den Namen "Fabrik" gegeben. Wie zieht sich dieser Gedanke durch die einzelnen künstlerischen Arbeiten?
Dieser Gedanke wird auf verschiedenen Ebenen eingelöst. Es geht um Arbeit und Ökonomie. In dem Video von Jasmina Metwaly und Philipp Rizk ist es offensichtlich, weil es um eine privatisierte und dann abgewickelte Fabrik geht. In der Arbeit von Hito Steyerl taucht der Begriff schon im Titel "Factory of the Sun" auf. Olaf Nicolais Arbeit wiederum ist nicht nur eine Performance von Artisten auf dem Dach, sondern eine Manufaktur, in der Bumerangs hergestellt und anschließend verkauft werden. Wenn man wiederum den Raum von Tobias Zielony betritt, steht man in einer Art Industriearchitektur, die so nie gesehen werden sollte und die es so auch nie gegeben hat. An der Stelle befand sich früher eine Art Gaze, ein Stoff, der ein Museumslicht im Stil des 19. Jahrhunderts gleichmäßig verteilt hat. Diese Unterzüge, mit denen das Gebäude erhöht worden ist, sollten wohl nie als solche so gesehen werden, aber das gibt dem Pavillon jetzt einen industriellen Charme, einen Ateliercharakter. Der Fabrik-Begriff ist aber auch eine Art Resonanz auf die Aktion von Okwui Enwezor, im Internationalen Pavillon dauerhaft "Das Kapital" von Karl Marx lesen zu lassen.
Auch die Biennale muss sich hin und wieder die Kritik gefallen lassen, kommerziell zu sein.
Ja, es ging stark durch die deutschen Feuilletons, dass die Biennale in der Zwickmühle steckt, eine Kritik des spätkapitalistischen Systems zu betreiben und gleichzeitig auf große Galerien setzt, um die Ausstellung zu füllen. Diese Kritik ist problematisch, wenn man die finanzielle Bedingung nicht kennt, unter denen Kuratoren die Biennale in kürzester Zeit einrichten müssen. Dieses Problem hätte anders nach außen dringen und wahrgenommen werden können, aber Kritik ist immer schnell geübt. Andererseits ist man tatsächlich in seltsamen Paradoxien gefangen, wenn man in Venedig an den großen Yachten vorbeigeht. Das ist aber Teil dieser Welt, was durch diese Kritik eigentlich nur sichtbar gemacht wurde.
Die Konzepte, wie Länder ihre Pavillons bespielen, sind von Land zu Land unterschiedlich: Während einige Länder Wettbewerbe ausschreiben, für die sich Kuratoren bewerben, berufen andere Länder wie Deutschland Kuratoren, die den Beitrag mit Unterstützung der Mittlerorganisationen frei gestalten können. Wie frei haben Sie sich in der Umsetzung Ihrer Ideen gefühlt?
Mir wurden keine Grenzen gesetzt. Es war eine gute Erfahrung, mit dem ifa und dem Auswärtigen Amt (AA) zusammenzuarbeiten – so wie Elke aus dem Moore und Nina Hülsmeier mein Konzept unterstützt haben und mir auch das AA sehr wohlwollend gegenüberstand. Ich habe mich unterstützt gefühlt, auch wenn es zum Teil sehr politische Arbeiten sind, die Systemkritik betreiben und zum Dialog über Ökonomie einladen. Das sind Dinge, denen wir uns stellen müssen. Kunst kann genau das, wie Frank-Walter Steinmeier ja selbst jüngst in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Die Kunst habe die Chance, weniger ritualisiert zu arbeiten als die Politik oder der Journalismus.
Die ursprüngliche Biennale-Idee der nationalen Repräsentation ist in den letzten 25 Jahren immer wieder diskutiert worden. Welche Bedeutung hat sie heute?
Um die Jahrtausendwende schien die Idee zwar fast obsolet, aber ich glaube, dass es eine produktive Reibefläche ist, um immer wieder die Frage zu stellen: Was hat eigentlich dieser Ort, auf dem das italienische Wort "Germania" steht, mit Deutschland zu tun? Was haben wir mit den anderen zu tun? In welchem Verhältnis steht das Kunstgeschehen in Venedig zu Deutschland? Darauf findet jede Künstlergeneration, jeder
Kurator, eine andere Antwort.
In Venedig auszustellen, ist ein Auftritt vor der Weltöffentlichkeit, aber auch vor der internationalen Kritik. Wie gehen Sie persönlich mit Kritik um?
Für Kritik bin ich dankbar, sie ist wichtig, denn erst damit entwickelt man sich weiter, dadurch entstehen erst Debatten. Die Kritik setzt ja bereits mit der Wahl der Künstlerinnen und Künstler ein, bevor etwas zu sehen ist. Besonders fruchtbar wäre Kritik, wenn sie differenziert das benennt, um was es im Pavillon geht: Was wird da verhandelt? Greift die Kunst etwas auf, was dem Geist unserer Zeit entspricht? Wie ist es umgesetzt?
Eine Frage zum Schluss: Wann und was haben Sie das letzte Mal fotografiert?
Zuletzt in den Giardini, Eidechsen rund um den Deutschen Pavillon. Es sind Suchbilder, also stark abstrahierte Bilder für meine Tochter, auf denen man die Eidechsen erst nach und nach erkennt. Die Fotos sind zwar ganz gut, aber nichts, das die Fotografie revolutionieren wird.